|
|
|
In
diesem Artikel sollte es eigentlich nur um die Siegelmarken auf der
Post von Höfischen Ressorts gehen. Bei der Vorbereitung hat sich
dann aber gezeigt, daß man kein Bild in die Luft hängen kann – es
braucht eine Wand für den Nagel.
Daher
vorweg einige Infos und Literaturhinweise für Interessierte am
Kaiserlichen Hof zum Verständnis. Ich gestehe, das ist dann doch
umfangreicher geworden, als gedacht… |
|
|
|
1. Der
Kaiserliche Hof |
|
|
|
 Wer
sich mit dem Hof des letzten Kaisers beschäftigen möchte, sollte
zuerst versuchen sich einen Überblick über das Selbstverständnis und
die Organisation der höfischen Gesellschaft zu verschaffen. Das ist
nicht leicht, denn obwohl wir uns im industriellen Zeitalter und
einer bürgerlichen Gesellschaft befinden, ist das Hof-Reglement
Kaiser Wilhelms II. im Vergleich mit einem absolutistischen Staat
des 18.Jahrhunderts nicht simplifiziert, sondern in vielen Bereichen
sogar exzessiv ausgebaut worden. Ausgehend vom höfischen Fundament
Preußens wurde einiges „aufgesattelt“, das als Nebeneffekt, Unmengen
an Geld verschlang. Wer
sich mit dem Hof des letzten Kaisers beschäftigen möchte, sollte
zuerst versuchen sich einen Überblick über das Selbstverständnis und
die Organisation der höfischen Gesellschaft zu verschaffen. Das ist
nicht leicht, denn obwohl wir uns im industriellen Zeitalter und
einer bürgerlichen Gesellschaft befinden, ist das Hof-Reglement
Kaiser Wilhelms II. im Vergleich mit einem absolutistischen Staat
des 18.Jahrhunderts nicht simplifiziert, sondern in vielen Bereichen
sogar exzessiv ausgebaut worden. Ausgehend vom höfischen Fundament
Preußens wurde einiges „aufgesattelt“, das als Nebeneffekt, Unmengen
an Geld verschlang.
John
C. G. Röhl, der die detaillierteste, wenn auch wenig freundliche
Biografie Kaiser Wilhelm II. verfasste, gibt in seinem Text
„Hof und Hofgesellschaft unter Kaiser Wilhelm
II.“ 1 einen zusammen-fassenden
Überblick, der den Leser oftmals fassungslos den Kopf schütteln
lässt. Hier seine Einleitung: |
|
|
|
Auf
dem Höhepunkt seiner Industrialisierung zeitigte Preußen-Deutschland
unter Kaiser Wilhelm II. eine in seiner ganzen Geschichte noch nie
dagewesene – man könnte sagen monströse
2
- Spätblüte der höfischen Kultur. Ob sie vom „Glanz der Krone"
3
in jener „Herrlichen Kaiserzeit" 4
schwärmten oder
„das Bombastische, das pomphaft Glänzende und Prahlerische"
5
dieses Kulturphänomens beklagten, die Zeitgenossen waren sich darin
einig, daß neben dem Aufstieg zu einer Industrie- und Großmacht
ersten Ranges, neben der allerseits bewunderten rationellen
Organisation seiner staatlichen und militärischen Einrichtungen das
prunkhafte Luxurieren einer neoabsolutistischen Hofkultur zu den
charakteristischsten Merkmalen des wilhelminischen Kaiserreiches zu
zählen sei. |
|
|
|
|
1 |
Röhl, John C.
G. (1985): Hof und Hofgesellschaft unter Kaiser Wilhelm II.
In: Hof, Kultur und Politik im 19. Jahrhundert. Ludwig
Röhrscheid GmbH, Verlag, Bonn. S. 237–289. Online unter:
https://www.perspectivia.net/publikationen/phs/werner_hof/roehl_hof. |
|
2 |
Vgl.
Nicolaus SOMBART, The Kaiser in his epoch : some reflexions
on Wilhelmine society, sexuality and culture, in : John C.
G. RÖHL und Nicolaus SOMBART (Hg.), Kaiser Wilhelm IL New
Interprétations. Cambridge 1982, S. 287. |
|
3 |
Herzogin
Victoria Luise, Im Glanz der Krone. Erinnerungen. München
1967. Charakteristisch für die höfische Geschichtsschreibung
der wilhelminischen Epoche ist das dreibändige Werk des
Hausarchivars Dr. Georg SCHUSTER, Geschichte des Preußischen
Hofes, Berlin 1913. |
|
4 |
Otto-Ernst
SCHÜDDEKOPF, Herrliche Kaiserzeit. Deutschland 1871-1914.
Mit einer Einführung von Hans Joachim SCHOEPS, Frankfurt
Berlin Wien 1973. |
|
5 |
So der
Sozialdemokrat Adolph Hoff mann im Preuß. Abgeordnetenhaus,
am 7. Juni 1910. Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten,
21. Legisl. III Session 1910, S. 6649. |
|
|
|
|
Beispielhaft
für die steifen Reglementierungen die offizielle Rangfolge am Hofe
mit 62 hierarchischen Stufen, die über Einfluss, Sitzordnungen,
Einladungen und Reihenfolge des Einzugs und Vorstellungen entschied: |
|
|
1. Der
Oberst-Kämmerer
2. Die General-Feldmarschälle
3. Der Minister-Präsident (und Reichskanzler)
4. Der Oberst-Marschall
5. Der Oberst-Truchsess
6. Der Oberst-Schenk
7. Der Oberst-Jägermeister
8. Die Ritter des Hohen Ordens vom Schwarzen Adler
9. Die Kardinäle
10. Die Häupter der nachstehend aufgeführten fürstlichen
und ehemals reichsständischen
|
|
gräflichen Familien in nachstehender Ordnung: |
| |
| |
Arenberg
Salm-Salm
Fürstenberg
Thurn und Taxis
Solms-Braunfels
Croy-Dülmen
Hohenlohe-Oehringen
Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst
Wied
Solms-Lich und Hohensolms
Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Sayn-Wittgenstein-Hohenstein
Bentheim-Bentheim und Bentheim-Steinfurt
Salm-Horstmar
Bentheim-Tecklenburg-Rheda
Isenburg-Büdingen in Wächtersbach
Isenburg-Büdingen in Meerholz
Solms-Rödelheim
Stolberg-Wernigerode
Stolberg-Stolberg
Stolberg-Rossla
Bentinck
Radziwill
Carolath-Beuthen
Lichnowski
Sagan
Hatzfeldt-Trachenberg
Biron von Curland
Blücher von Wahlstatt
Sulkowski
Lynar
Putbus
Salm-Reifferscheidt-Dyck
Pückler-Muskau
Sayn-Wittgenstein-Berleburg (Ludwigsburgische
Speziallinie)
Rhein-Wolbeck
Pless
Rohan
Hatzfeldt-Wildenburg
Bismarck |
| |
11. Der
Vice-Präsident des Staats-Ministeriums
12. Die aktiven Generale der Infanterie und Kavallerie
13. Der Minister des Königlichen Hauses und die aktiven
Staats-Minister
14. Die ersten Präsidenten beider Häuser des Landtags
15. Die inaktiven Generale der Infanterie und der
Kavallerie, welche als solche
patentiert gewesen sind
16. Die inaktiven Staats-Minister, welche bei ihrem
Ausscheiden der Ministerrang
vorbehalten ist
17. Die inaktiven Generale der Infanterie und
Kavallerie, welche nicht als solche
patentiert gewesen sind
18. Die aktiven Generals-Lieutenants
19. Die Wirklichen Geheimen Räte mit Excellenz-Prädikat
20. Die Erzbischöfe und die gefürsteten Bischöfe
21. Die inaktiven General-Lieutenants, welche als solche
patentiert gewesen sind
22. Die mit Excellenz-Prädikat begabten Ober-Hofchargen
23. Die Ober-Hof-Ämter im Königreich Preußen
24. Die inaktiven Generals-Lieutenants, welche als
solche nicht patentiert
gewesen sind
25. Die sonst mit Excellenz-Prädikat begabten Personen
26. Die Nachgeborenen der unter 10. Aufgeführten
fürstlichen und gräflichen
Häuser, falls sie das Cordon eines preußischen Ordens
besitzen.
27. Die Vice-Präsidenten beider Häuser des Landtags
28. Die Ober-Präsidenten, sofern sie persönlich nicht
einen höheren Rang haben
29. Die aktiven Generals-Majors
30. Die Räte I.Klasse und die ihnen im Rang
gleichstehenden Beamten
31. Die Bischöfe beider Konfessionen
32. Die Ober-Hofchargen ohne Excellenz-Prädikat
33. Die inaktiven General-Majors
34. Die Vice-Ober-Hofchargen
35. Die Obersten
36. Die Räte II.Klasse und die ihnen im Rang
gleichstehenden Beamten
37. Die General-Superintendenten, soweit sie den Rang
der Räte II.Klasse haben
38. Die Feldpröbste beider Konfessionen
39. Der Ober-Bürgermeister von Berlin
40. Die Dompröbste und die Dechanten der Stifter
41. Die Schlosshauptleute
42. Die übrigen Königlichen Hofchargen und die
Hofmarschälle Ihrer Königlichen
Hoheiten der Prinzen des Königlichen Hauses, voran der
Hofmarschall Seiner
Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen
43. Die Königlichen Kammerherren
44. Die Flügel-Adjutanten Seiner Majestät des Kaisers
und Königs
45. Die Inhaber der Erbämter in den Provinzen
46. Die Ober-Hof- und Domprediger und die ihnen im Rang
gleichgestehenden
katholischen Geistlichen
47. Die Rektoren der Universitäten und die beständigen
Sekretäre der Akademie
der Wissenschaften, sowie der Präsident und Direktor der
Akademie der Künste
48. Die Oberst-Lieutenants
49. Die Räte III.Klasse
50. Die Landes-Direktoren (Landeshauptleute)
51. Die General-Landschafts- und
Haupt-Ritterschafts-Direktoren
52. Die Domherren
53. Die Ritterschafts- und Landschafts-Direktoren
54. Die Majors
55. Die Räte IV.Klasse
56. Die Landschaftsältesten und Landschaftsräte
57. Die bei Hofe vorgestellten Herren
58. Die Mitglieder beider Häuser des Landtags
59. Die Hauptleute und Rittmeister
60. Die Kammerjunker und Hofjagdjunker
61. Die Premier-Lieutenants
62. Seconde-Lieutenants |
|
|
|
|
Dies
soll an dieser Stelle reichen, um die komplexe Etikette erahnen zu
können und den Hof von seiner Struktur her einzuordnen. Nun zu einer
anderen Seite, nämlich der Außenwirkung. Es gab auch damals schon
das, was wir heute als Klatsch und Tratsch aus der „Yellow Press“
kennen. Hier gab es nicht nur sensationsheischende Sex-Skandale
sondern auch ganze Bücher mit Lebenserinnerungen und Enthüllungen
von „Insidern“. Unterscheiden muß man Veröffentlichungen von vor
1918, kurz nach dem Sturz der Monarchie aus den 1920ern und die
wenigen aktuellen Werke, die sich einigen Skandalen widmen.
Sich
durch diese Veröffentlichungen (man mag einiges nicht Literatur
nennen) zu kämpfen ist mühsam, manchmal verstörend, abstoßend oder
peinlich, nur selten interessant. Für den Büchersammler jedoch auch
ein mögliches, wenn auch sehr ausgefallenes, bizarres Sammelgebiet.
|
|
|
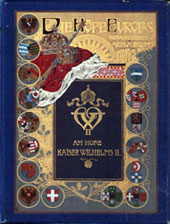 |
Die Höfe Europas – Am
Hofe Kaiser Wilhelms II.
Hrsg. Arthur Brehmer
Neuer Verlag Berlin, 1902
Großer Prachtband mit 702 Seiten und vielen Bildern. Wohl
das schönste Buch zum Thema.
|
| |
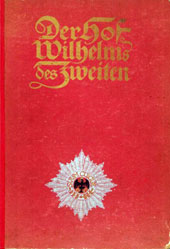 |
Der Hof Wilhelms des
Zweiten
Hrsg. Seidenhaus Michels & Cie, Berlin
Willi Simon Verlag 1910
Mit Hofkalender 1911. Möglicherweise Kundengeschenk mit
vielen Bildern höfischer Damengarderobe. |
| |
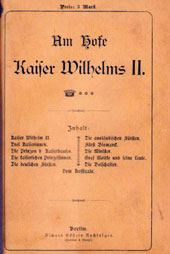 |
Am Hofe Kaiser Wilhelms
II.
Anonym (= Hermann Robolsky)
Richard Eckstein Verlag, Berlin 1888
Der Lehrer und Publizist macht eher eine Art Momentaufnahme
zum Ende des Jahres 1888 über die Ereignisse der
Thronbesteigung, die Regierung, Minister und Botschafter.
Insofern ein etwas irreführender Titel. |
| |
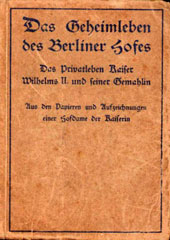 |
Das
Geheimleben des Berliner Hofes –
Das Privatleben Kaiser Wilhelms II. und seiner Gemahlin
Aus den Papieren und Aufzeichnungen einer Hofdame der
Kaiserin (= Ursula Gräfin von Eppinghoven)
Englische Erstveröffentlichung 1904 in London, bis 1909
sechs Auflagen auch in New York. Im Deutschen Reich
verboten, erst 1918 deutsche Übersetzung durch Esther Booth.
(Gustav Ziemsen Verlag, Berlin). |
 |
|
|
|
|
Neben
der gängigen Kurz- eine dreibändige Komplettversion (The Kaiser 558
Seiten und The Kaiserin 191 Seiten). Diese auch in limitierter,
ledergebundenen Deluxe-Ausgabe auf Büttenpapier mit einigen Fotos.
In Deutsch ist nur die gekürzte Version mit 310 Seiten erschienen.
Die
ehemalige Hofdame schüttet einen Kübel von Marginalien aus dem
Privatleben des Kaiserpaares aus, daneben unzählige Gesprächsnotizen
über Gerüchte und Erzählungen vom „Hören-Sagen“. So kann man
erfahren, was für Notizzettel im Schlafzimmer und Bett herumlagen,
daß der Kaiser Angst vor an- steckenden Krankheiten hatte, wie mit
dem oder der Bediensteten umgegangen wurde, wer dies oder jenes
gehört hatte und so weiter. Der 3.Band, der sich praktisch nur mit
der Kaiserin beschäftigt, bringt spektakuläre Informationen, daß sie
versuchte mit Jod-Tabletten abzunehmen, oder ihr die Füße in zu
kleinen Schuhen schmerzten, da der Kaiser angeblich kleine Füße
mochte.
Das
Niveau ist auf dem Level von typischen, trivialen
Frauenzeitschriften. Trotzdem oder grad deswegen und wohl weil es
bis 1918 in Deutschland verboten war, wurde das Buch zum Bestseller.
|
|
|
 |
Hofgeschichten
Werner Kautzsch
Gustav Ziemsen Verlag, Berlin 1922 und 1927
Nach dem Ende der Monarchie fühlte sich der Autor berufen,
eine Zusammenfassung aus dem oberen Buch der Hofdame und den
Erinnerungen des kaiserlichen Zahnarztes, Artur Nathan Davis
zu schreiben, die 1918 in New York erschienen sind („The
Kaiser as I know him“). In der zweiten Auflage 1927 dann
aufgrund von Archiv-Veröffentlichungen über-arbeitet und
korrigiert. |
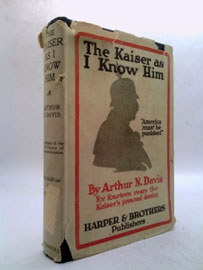 |
|
|
|
|
Das
Ganze hat den Anschein, als wollte der Autor 1922 von der Nachfrage
nach „Enthüllungsbüchern“ profitieren indem er woanders abschrieb
und sich 1927 genötigt sah, sein Buch zu überarbeiten, wobei
inzwischen bewiesenermaßen falsche Aussagen korrigiert wurden.
|
|
|
 |
Zwölf Jahre am deutschen Kaiserhof
Aufzeichnungen des Grafen Robert Zedlitz-Trützschler
ehemaligen Hofmarschalls Wilhelms II.
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1923
Wohl das ehrlichste Buch über den Hof, das zu der Zeit
schienen ist. Der ehemalige Hofmarschall berichtet aus
erster Hand von den Abläufen in der Organisation, den
herausfordernden Ansprüchen und den Umständen, die wegen
plötzlicher Launen des Kaisers entstanden waren.
Daneben immer wieder Einschätzungen und Bedenken über die
Neigung des Kaisers zu viel und zu offen zu reden. |
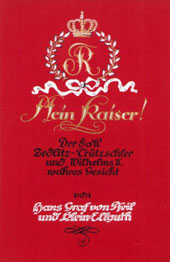 |
|
|
|
|
So
wenn vertrauliche Regierungsangelegenheiten bei Diners und Bällen
ausgeplaudert wurden, weil der Kaiser sich zu gern reden hörte. Das
alles leitet der Autor mit Erinnerungen aus der Jugend und
Militärzeit ein, worin er seine politische Einstellung und
Überzeugungen herleitet. Man spürt eine tiefe Enttäuschung und
Desillusionierung, weil der Alltag am Hof nicht den Ansprüchen
genügt, die der Autor für angemessen und notwendig hält.
Besonders
vom deutschen Adel prasselten nach der Veröffentlichung schwere
Vorwürfe auf den Grafen Zedlitz-Trützschler nieder. Er wurde als
Nestbeschmutzer beschimpft, was grad bei einem Adligen unmöglich
wäre, sein Buch sei voller Lügen und Anekdoten, die er sich nach
1918 ausgedacht habe, um im Buch als jemand zu erscheinen, der es ja
schon immer besser gewusst habe.
Als
herausragendes Beispiel dieser Missbilligungen erschien sogar
umgehend ein ganzes Buch als Entgegnung: „Mein Kaiser! – Der Fall
Zedlitz-Trützschler und Wilhelm II. wahres Gesicht“ von Hans
Graf von Pfeil und Klein-Ellguth (Leipziger Graphische Werke, 1923).
Ein schwer zu lesendes Buch mit einer Anreihung von Punkten aus
Zedlitz-Trützschlers Buch und Versuchen Graf Pfeils diese als Lügen
oder Phantasiekonstrukte zu entlarven. Dazwischen immer wieder eine
fassungslose Entrüstung, daß ein Graf so ein ungehöriges
Enthüllungsbuch geschrieben hat. |
|
|
|
|
|
|
|
Als
neuere Literatur sei genannt. „Skandal im Jagdschloss Grunewald“
von Wolfgang Wippermann (Primus-Verlag 2010), worin versucht wird
einen Sex-Party-Skandal von 1891/96 bis ins Detail aufzuarbeiten.
Norman Dormeier widmet sich in „Der Eulenburg-Skandal“
(Campus Historische Studien, 2010) vor allem den Aspekten zur
Homosexualität im Umfeld des Kaisers und deren öffentliche
Wahrnehmung, bzw. Ausschlachtung. Schlussendlich natürlich der
Hinweis auf das beste Fachbuch zum Thema von John C. G. Röhl
„Kaiser, Hof und Staat“ (C. H. Beck 1987) mit vielen gut
recherchierten und verblüffenden Angaben. |
|
|
|
2. Die
Siegelmarken der Post vom Kaiserlichen Hof |
|
|
|
Höfische Abläufe,
Organisation und Zeremoniell |
|
|
|
|
|
|
|
Die Kabinette, die
Bindeglieder zwischen Hof und Staat (Röhl) |
|
|
|
|
|
|
|
Finanzen und
Schlossbau |
|
|
|
|
|
|
|
Persönliche
Angelegenheiten, der General- und die Flügeladjutanten |
|
|
 |
|
|
|
Reichskolonialamt.de
© 2025 |
| |
|
|
